Die Kommune von Paris 1871 und wie es zur Revolution kam
von dm
Von den Julitagen 1848 bis zum Vorabend der Kommune
Im Verlauf der ersten Hälfte des 19 Jh. veränderte sich das französische Sozialgefüge drastisch. Die in urbanen Zentren aufkommende Industrialisierung brachte die Entwicklung eines städtischen Proletariats mit sich, welches sich auch politisch als solches zu verstehen begann und ein Klassenbewusstsein entwickelte. So kam es im Juni 1848 zu einer weiteren Revolution und in deren Verlauf zum Bruch der französischen Gesellschaft.
Die Junitage des Jahres 1848 rissen einen Abgrund auf zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat von Paris, der bis jetzt noch niemals zugeschüttet wurde. Eine Bewegung wie die im Juli 1830 oder im Februar 1848 wurde unmöglich. 1
Im Dezember 1848 wurde Napoleon III zum Staatspräsidenten der zweiten Republik gewählt, die aus der Februar Revolution von 1848 hervorgegangen war. Im Dezember 1851 putschte er sich durch die Ausschaltung der Republikaner und Teile der Monarchisten an die Macht und begründete damit 1852 das zweite Kaiserreich. 2 Aussenpolitisch verfolgte der neue Kaiser eine expansive Politik. Im Innern trieb er die Industrialisierung und aufwendige Bauprojekte deutlich voran, was gerade in den Städten ein massives Bevölkerungswachstum mit sich brachte. Während grosse Teile Frankreichs immer noch ländlich geprägt waren, platzten die Industriezentren aus allen Nähten. Ende der 1860er Jahre endete der Bauboom und hinterliess ein Heer von Arbeitslosen. Hinzu kam, dass das Finanzsystem in Folge von übertriebener Spekulation kollabierte, was die Lage zusätzlich verschlimmerte. 3
In der entstehenden Situation versuchte der Kaiser die Gunst der ArbeiterInnen zu gewinnen und änderte daraufhin seine restriktive Arbeitspolitik. 4 So begann er die Bildung von „Arbeitervereinen“ zu fördern und begünstigten. Im Mai 1864 wurde gar ein Gesetz angenommen, welches Streiks legalisierte 5 und im selben Jahr wurden auch die Gewerkschaften legalisiert. Im Jahr 1868 wurde die Zensur deutlich zurückgefahren und somit die Pressefreiheit gestärkt, 6 weiter wurde im selben Jahr ein Gesetz „über die Legalität öffentlicher Versammlungen“ 7 verabschiedet.
Gestärkt durch die erhaltenen Freiheiten verbreiteten sich neue politische Ideen rasant, so vermochte es die Internationale in Frankreich eine wichtige Sektion aufzubauen. 8 Doch auch das Klubwesen, welches schon die Revolution von 1789 geprägt hatte, kehrte auf das politische Parkett zurück. Als Folge politisierte sich die Arbeiterschaft aufs Neue und Klassenunterschiede wurden verstärkt angeprangert. Als der kaiserlichen Administration bewusst wurde, dass ihr die Kontrolle über die Arbeiterschaft zu entgleiten begann, antwortete sie mit massiver Repression. So wurden ab März 1868 Mitglieder der Internationalen verhaftet und verurteilt, und die Organisation als solches wurde faktisch verboten. 9
Obwohl sich das Kaiserreich Napoleons III in einer schlechten Verfassung befand, reagierte es auf preussische Provokationen und der Preussisch-Französische Krieg brach im Sommer 1870 aus. Der Kriegsverlauf wandte sich gegen die deutlich unterlegenen Franzosen. Doch brodelte es auch im Innern und die Machthaber standen zwischen der äussern Front gegen die Preussen und der sich zu erheben drohenden Arbeiterschicht.
Als die Nachricht über die Niederlage bei Sedan nach Paris gelangte, hatte das Kaiserreich keinen einzigen Verteidiger mehr. Die Ausrufung der Republik war ein so ruhig und ohne Aufhebens vollzogener Akt, als ob es sich um eine ganz gewöhnliche und alltägliche Sache handelte. 10
Mitten im Krieg wurde also die dritte Republik konstituiert und an die Spitze des Staates stellte sich eine konservative Regierung der Nationalen Verteidigung. Doch lauerte auch im Verständnis dieser Regierung die grössere Gefahr für das bürgerliche Frankreich im Innern. Die Angst vor einer „roten“ Revolution war grösser als jene vor den Preussen. Dies führte dazu, dass trotz der drohenden Niederlage die Nationalgarde, eine Art Volksbewaffnung deren Wurzeln in der „Levée en masse“ von 1792 und dem Jakobinertum liegen, nicht konsequent eingesetzt wurde. Als am 31. Oktober 1870 bekannt wurde, dass Thiers im Namen der Regierung der Nationalen Verteidigung über einen Waffenstillstand mit den Preussen verhandelte, kam es zu einem Aufbäumen der Pariser Arbeiter und ArbeiterInnen und Nationalgardisten, deren Anführer auf eine „levée en masse“ nach dem Vorbild von 1792/93 drängten. 11
Das Rathaus wurde besetzt, um die Regierungsgewalt zu übernehmen, denn die Aufständischen waren nicht gewillt der Passivität der neuen Regierung weiter zuzusehen. 12 Die Revolte scheiterte aber kläglich und anstelle die Macht zu übernehmen, schwand der Einfluss des erst gerade gebildeten Zentralkomitee der zwanzig Pariser Bezirke und das gegenseitige Misstrauen steigerte sich weiter. Trotz der Scheitern des Aufstandes, vermochten dei Pariser den Druck gegen die Preussen zu kämpfen, aufrecht zu halten. So wurde am 29. November 1870 ein Ausfall gegen die Preussen gestartet, innert drei Tagen fielen an die 12‘000 französische Soldaten. Auch ein zweiter Ausfall am 21. Dezember endete in einer Katastrophe. Diese militärischen Niederlagen führten zum erneuten aufbrechen offener Feindseligkeiten zwischen der Regierung und den immer noch kampfbereiten ArbeiterInnen und Nationalgardisten. So wurde erneut durch das Zentralkomitee der zwanzig Pariser Bezirke der Aufruf zur Konstituierung der Kommune proklamiert. 13
Bei einem weiteren Versuch einen Ausfall gegen die Preussen zu starten, wurde die Nationalgarde aufgeboten und es standen an die 100‘000 Männer zum Kampf bereit, wovon aber nur ein kleiner Teil in die Schlacht geschickt wurde. Logistisch wie militärstrategisch war das Unterfangen zum Scheiterten verurteilt und endete ein weiteres Mal im Chaos. 14 Daraufhin erreichte die „Erregung“ gegen die Regierung einen Höhepunkt und „am Abend des 21. Januars wurde in den Sektionen der Internationalen ein Aufruf zu den Waffen für den folgenden Morgen verteilt“. 15 Der Aufstand kam jedoch nicht zu Stande und am 28. Januar 1871 wurde die Kapitulation von Paris unterzeichnet. Da nun die Regierung der Nationalen Verteidigung durch die Niederlage ihre Legitimation verloren hatte, wurden für den 8. Februar Wahlen angesetzt. Aus den Wahlen gingen als deutliche Sieger die Konservativen und Monarchisten hervor, welche vor allem auf dem Land Stimmen gewonnen hatten. In der in Bordeaux tagendenden 675 Abgeordnete zählenden Nationalversammlung, waren gerademal 150 Vertreter des Republikanertums. 16 Zum Chef der Exekutive wurde der konservative Republikaner Thiers gewählt, welcher später dann auch der erste Präsident der Dritten Republik werden sollte; 17 Regierungssitz wurde Versailles.
Die ersten Amtshandlungen der neuen Regierung Paris betreffend, dienten nicht der Beruhigung der Situation. „Die Patrioten“ enttäuscht von der Kapitulation, waren ihrerseits unzufrieden und der drohende Einmarsch der Preussen zehrte am Pariser Selbstverständnis. Lawrow beschreibt die Situation wie folgt:
Dieses Paris, das soeben noch in dem erregten Zustand der Belagerung gelebt hatte, […] jeden Augenblick in Erwartung des Eindringens der Feinde und zugleich plötzlich der Willkür zufälliger Interessen und Einflüsse ausgesetzt, erhielt aus Bordeaux Nachrichten, die die Interessen der Mehrheit in äusserstem Masse kränkten […]. Das gesamte Kleinbürgertum von Paris war durch die Verfügung vom 11. März in seinen Lebensinteressen verletzt, die besagte, dass alle Wechsel, deren Laufzeit am 13. November 1870 zu Ende gegangen war, am 13. März eingelöst werden müssten (d.h. zwei Tage nach dem Erlass dieser Verfügung, und das in einer Stadt, in der das geschäftliche Leben gerade erst wieder begann). Zugleich lehnet es die Versammlung ab, den Wohnungsmietern zu helfen […], die den Mietsherren die letzten Monate nicht bezahlt hatten und gar nicht hatten bezahlen können. 18
Weiter war für Paris die Tatsache, dass die Regierung weg gezogen war eine gänzlich neue, es fehlte an Polizei auf der Strasse und auch der installierte General hatte zu wenig Mittel, um als Regierungsvertreter Anerkennung zu finden. 19 In dieser Situation, gefördert von einem Besoldungsstreit mit der Zentralregierung, bildete sich die demokratisch orientiere Föderation der Nationalgarde mit einem Zentralkomitee an seiner Spitze. Es kam zu entschlossenen Demonstrationen, in deren Verlauf die Kommune gefordert wurde und auf dem Place de la Bastille wurde erneut die Rote Fahne gehisst. 20 Parallel dazu verabschiedeten die Delegierten der Zwanzig Pariser Bezirke am 23. Februar 1871 eine Resolution für die Bildung einer revolutionären sozialistischen Partei. 21 Nichts desto trotz stand der Einmarsch der Preussen bevor und als bekannt wurde, welche Teile von Paris besetzt werden sollten, ging ein Aufschrei durch die Stadt, denn die Kanonenlager der Nationalgarde sollten in die Hände der Preussen fallen. Kurzentschlossen wurden die Kanonen unter der Leitung des Zentralkomitees der Nationalgarde in die ArbeiterInnenquartiere „in Sicherheit“ gebracht. 22
Die 72 Tage der Pariser Kommune
An diesen Kanonen entbrannte dann auch der bewaffnete Konflikt, welcher zur Ausrufung der Kommune führte. Da sich die Nationalgarde weigerte die Kanonen zurückzugeben, versuchte die Regierung in Versailles sie militärisch zurückzugewinnen. Am 18. März 1871 marschierten Versailler Truppen um drei Uhr Morgens in Paris ein. Aus Mangel an Pferden dauerte der Abtransport der Kanonen zu lange, sodass die Pariser ArbeiterInnen beim Erwachen alarmschlugen. Die Truppen wurden durch die Nationalgardisten und ArbeiterInnen geschlagen und die „Evakuierung“ von Paris wurde durch Versailles eingeleitet. Der Aufstand begann als Verteidigung der Kanonen, endete aber in der politisch motivierten erneuten Besetzung des Rathauses. 23
Aus Mangel an einer gewählten Struktur übernahm das Zentralkomitee der Nationalgarde die Regierungsgewalt, rief aber für den 22. März Wahlen aus. 24 Auf 20‘000 Bewohner sollte ein Gemeinderat entfallen, so lautete der Wahlmodus zur Sicherstellung, dass die ArbeiterInnenbezirke gerechter vertreten sein würden. 25 Wegen konterrevolutionären Demonstrationen, welche in Schiessereien gipfelten, wurden die Wahlen auf den 26. März verschoben, an welchem sie dann auch mit ansprechender Wahlbeteiligung durchgeführt wurden. 26 Zur Zusammensetzung des Kommunalrates schrieb Lawrow:
In ihm befanden sich die Vertreter der neuen Bewegung des Arbeitersozialismus, aber sie befanden sich in der Minderheit; sie setzten sich zusammen zum Teil aus Arbeitern, die Aufgrund des wachsenden Einflusses der Internationalen gewählt worden waren […] zum Teil aus Vertretern der sozialistischen Presse und der Volksversammlungen […] so wie aus einzelnen Persönlichkeiten der Herrschenden Klassen, die sich der Internationalen und dem Sozialismus angeschlossen hatten. Die Mehrheit versammelte sich um das traditionelle Programm des revolutionären Jakobinismus […], oder um das Blanquische Programm der Diktatur. Zu diesen Revolutionären Elementen […], gesellten sich […] auch die Widersacher dieser Revolution. 27
Bookichin bemerkt, dass in dem neuen Rat lediglich vier oder fünf Industriearbeiter vertreten waren. 28 Die 15 Sitze der „Widersacher der Revolution“, beweisen aber auch, dass auch Menschen an den Wahlen teilgenommen hatten, die der Kommune eigentlich ablehnend gegenüberstanden. Trotz ihrer Wahl waren sie nicht in der Kommune vertreten, da sämtliche 15 Abgeordnete von ihren Mandaten zurückgetreten waren. 29 Am Abend des 28. März wird die Kommune offiziell ausgerufen und Tags darauf erschien das erste Plakat des Kommunalrates mit der Überschrift „Republique Française“ und darunter „Liberté – Egalité – Fraternité“. 30 In seiner ersten Sitzung verabschiedet die Kommune eine Reihe von Dekreten, welche vor allem die Mieten betrafen und diese für die Zahlungen, welche während des Kriegs angefallen waren und oftmals noch ausstehend waren, erliessen. Weiter wurde verfügt, dass die Verkäufe der in den Pfandhäusern hinterlegten Güter ausgesetzt werden müssen. 31 In der zweiten Sitzung wandte sich der Kommunalrat dem dringenden Problem der Reorganisation der öffentlichen Strukturen zu. Dies weil, die Verwaltungsstrukturen wegen eines Massenexodus der alten Verwaltung unmittelbar nach der Revolution nahezu gänzlich zusammengebrochen war. Es wurden neun Kommissionen gegründet, 32 welche sofort die Arbeit aufnahmen und innert kurzer Zeit das öffentliche Leben wieder in Gang zu bringen vermochten. In derselben Sitzung, wurde die Konskription abgeschafft und alle wehrfähigen Männer zur Nationalgarde berufen. 33
Doch stand die Kommune auch vor der Herausforderung einen Krieg zu führen. Denn obwohl nicht wenige die Hoffnung hegten, dass der Konflikt mit Versailles friedlich beigelegt werden könnte, standen die Zeichen auf Sturm. Die Kommune verfügte über ein Heer von rund 200‘000 Nationalgardisten, welche sich in Anlehnung an die Nationalgardisten von 1789 „fédérés“ nannten, 34 stand aber vor dem Problem, dass sie nicht wirklich über fähige Armeekader verfügte und auch die Soldaten oftmals nur schlecht geschult waren. Weiter wurde auch das Verhältnis zwischen dem Kommunalrat und des Zentralkomitees der Nationalgarde nie richtig geklärt, was zu verwirrenden Situation führte. So wurde zum Beispiel am 3. April 1871 als Reaktion auf die ersten Angriffe durch Versailler Truppen auf Paris ein Gegenangriff auf Versailles gestartet, ohne dass der Kommunalrat darüber informiert worden war. 35
Auf dem politischen Parkett trieb der Kommunalrat seine Arbeit voran. Per Dekret wurden die höchsten Löhne der Republik auf 6‘000 Francs festgesetzt und eine Angleichungskampagne der Löhne durchgeführt. 36 Am 16. April folgte das Dekret über die Übergabe der verlassenen Werkstätten an Arbeitergenossenschaften. Dies ist eines der wenigen Dekrete, welches den Privatbesitz indirekt angreift und eine explizit sozialrevolutionäre Position einnimmt. Abgeschwächt wurde das Dekret aber durch den Beschluss, den einst zurückkehrenden Besitzern Entschädigungszahlungen zu leisten. 37 Ganz allgemein standen die tatsächlich gegründeten Kooperativen, zirka 40 an der Zahl, vor dem Problem, dass die Kommune auf dem Markt diese Kooperationen nicht bevorzugte und weiterhin von den billiger produzierenden kapitalistischen Fabriken ihre Waren bezog. Diese Politik sollte erst am 12. Mai korrigiert werden. 38
Vor den Toren von Paris wurde weiter heftig gekämpft und die Versailler Truppen zogen den Kreis immer enger um die Stadt, unterstützt wurden sie von Mitte Mai an auch durch die von den Preussen entlassenen Kriegsgefangenen, welche seit dem Preussisch- Französischen Krieg inhaftiert waren. Häufige Wechsel an der militärischen Spitze der Kommune, allgemeine Verwirrung und Disziplinlosigkeit der Nationalgardisten taten das ihrige dazu, dass sich das Kriegsglück nicht wandte. 39
Am 20. April wurde das einzige Manifest der Kommune veröffentlicht. Das Manifest sucht Anschluss an die revolutionäre Tradition Frankreichs. Über die Forderung nach autonomer Gemeindeverwaltung geht es im Wesentlichen nicht hinaus, nahezu gänzlich fehlt das Erarbeiten von Visionen, was doch erstaunt, da Paris zum Zeitpunkt der Verfassung schon belagert gewesen sein musste.
Die Kommune hat kein anderes Ziel als das Recht auf Gemeindeverwaltung, das alle ihr zustimmenden Gemeinden gleichmässig geniessen sollen. […] Die Kommune will administrative und wirtschaftliche Reformen, die die Bevölkerung fordert, […] sie will das Vermögen und das Eigentum verallgemeinern nach den Notwendigkeiten des Augenblicks […]. Unsere Feinde täuschen sich wenn sie Paris anklagen, die Einheit Frankreichs, die durch die Revolution geschaffen worden ist, zerstören zu wollen. […] Was uns betrifft, Bürger von Paris, so haben wir die Aufgabe, die grossartigste und folgenreichste Revolution der Neuzeit durchzuführen. Auf uns ruht die Pflicht zu siegen oder zu sterben. 40
Nachdem sich auch politisch die Lage verschärft hatte und es innerhalb der Kommune brodelte, stellt Miot Ende April den Antrag eine Wohlfahrtsausschuss zu bilden. 41 In einer Abstimmung am 1. Mai wird dieser auch konstituiert, aber nicht ohne heftigen Disput innerhalb der Kommune auszulösen. 42 Denn es war nicht vergessen, dass es eben jene Institution war, welche 1793 zum Gefäss einer autoritären Diktatur mutierte und unter Robespierre 1794 zur Zerschlagung der Kommune diente. 43 Doch auch dieser tiefgreifende Schritt half nichts mehr. Die Kommune war in einen verbitterten Bürgerkrieg verwickelt und viele der Dekrete waren eher symbolischer Natur und richteten sich nicht selten gegen Einrichtungen wie Kirchen und Monumente, so wurde zum Beispiel am 16. Mai die Vendôme- Säule niedergerissen. 44 Einige Dekrete tangierten dann doch noch realpolitische Probleme, so wurde Anfangs Mai verfügt den Brotpreis festzusetzen und kurzzuvor war schon die Nachtarbeit für Bäcker verboten worden. 45
Militärisch wurde die Lage misslicher, dies obwohl immer noch eine grosse Zahl von an die 170‘000 Nationalgardisten verfügbar war. Schafer relativiert diese Zahl jedoch und spricht von gerademal 25‘000 - 30‘000 welche Anfang Mai die Stadt noch verteidigten und um Mitte Mai von gerade mal noch 6‘000 Mann. 46 Am 20. April begannen die Versailler Truppen mit einem massiven Bombardement von Paris und marschierten Tags darauf in Paris ein. 47 Nun beteiligten sich auch wieder vermehrt die Arbeiter und teileweise auch Arbeiterinnen an der Verteidigung ihrer Quartiere. In ganz Paris wurden an die 600 Barrikaden gebaut und verwickelten so die Versiller Truppen in einen heftigen Strassenkampf. Doch Paris war nicht mehr zu halten und ab dem 23. Mai brachen in ganz Paris teils von den Kommunarden strategisch gelegt, teils durch die massiven Bombardements oder von in Rage geratener Nationalgardisten entfacht, grosse Brände aus. 48 Bis zum 28. Mai gingen die heftigen Kämpfe weiter, bis schliesslich die Kommune geschlagen war. 49 Die Versailler Truppen hatten mit äusserster Brutalität zugeschlagen, tausende Kommunarden wurden schon während den Kämpfen niedergemetzelt und viele weitere wurden im Verlauf der folgenden Massenexekutionen hingerichtet. Der Daily Telegraph schrieb am 25. Mai folgende Zeilen dazu:
Blut fliesst in den Rinnsteinen von Paris. Tote liegen in allen Strassen und erstarrte Leichen sind ein gewöhnlicher Anblick an jeder Ecke. Gardisten […] werden […] auf offener Strasse erschossen. Das Hinmorden von Nationalgardisten war seit dem 23. Mai fürchterlich. An diesem Tag begannen die Versailler alle ihre Gefangenen niederzumetzeln. […] Karren fahren umher, um die Toten aufzusammeln, deren Zahl sicherlich jede Schätzung übersteigt. […] Der Bereitwilligkeit zu töten waren keine Grenzen gesetzt. 50/51
Von offizieller Seite wurde von 17‘000 Toten seitens der Kommune gesprochen, Schätzungen von Historikern gehen von mindestens 30‘000 Opfern aus, während die Versailler Truppen 1‘200 Tote zu beklagen hatten. 52
___
1 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871. Geschehnisse- Einfluss- 2 Lehren, Münster 2003 (Ersterscheinung Genf 1880), S. 15. Lawrow spricht damit das 3 Aufklaffen eines Klassenkonfliktes an, welcher bis dahin in den französischen Revolutionen eher zweitrangig war.
4 Geiss, Imanuel: Geschichte Griffbereit. Personen, Band 3, Dortmund 1993, S. 218.
5 Bookchin, Murray: The Third Revolution. Popular Movements in the Revolutionary Era, Volume 2, London/Washington 1998, S. 194.
6 Shafer, David A.: The Paris Commune. French politics, culture and society at the crossroads of the revolutionary tradition and revolutionary socialism, Basingstoke 2005, S 14.
7 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 16.
8 Shafer, David A.: The Paris Commune, S 20.
9 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 17.
10 Theimer, Walter: Geschichte des Sozialismus, Tübingen 1988, S. 91.
11 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 197.
12 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 44.
13 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 204
14 Ebd. S. 207f.
15 Ebd. S. 209-211.
16 Ebd. S. 212.
17 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 54.
18 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 214.
19 Geiss, Imanuel: Geschichte Griffbereit, S. 207.
20 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 59.
21 Arnould, Arthur: Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, Bruxelles 1878, Buch I S. 92.
22 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 61.
23 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 214.
24 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 58.
25 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 60-63.
26 Ebd. S. 65.
27 Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich. März bis Mai 1871. Die Pariser Kommune in zeitgenössischen Berichten, Lüneburg2 2003, S. 25.
28 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 67f.
29 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 105f.
30 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 228.
31 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 69.
32 Bruhart, Jean/ Dautry, Jean/ Tersen Emile (Hgg.): Die Pariser Kommune von 1871, Berlin 1971, S. 110.
33 Ansprache der Kommune, veröffentlicht im Journal officiel, Paris 29. März 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 51.
34 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 73.
35 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 160.
36 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 217.
37 Arnould, Arthur: Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, Buch II S. 148.
38 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 155f.
39 Ebd. S. 167.
40 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 233f.
41 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 93ff.
42 Manifest der Pariser Kommune, Paris 20. April 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 91-94.
43 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 242.
44 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 73.
45 Kruse, Wolfgang: Die Französische Revolution, Paderborn/ München/ Wien/ Zürich 2005, S. 37.
46 Kölnische Zeitung, Paris 16. April 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 150f.
47 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 226.
48 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 79.
49 Ebd. 86f.
50 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 98f.
51 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 226.
52 Daily Telegraph, 25. Mai 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 183f.
53 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 97f.
22 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 61.
23 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 214.
24 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 58.
25 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 60-63.
26 Ebd. S. 65.
27 Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich. März bis Mai 1871. Die Pariser Kommune in zeitgenössischen Berichten, Lüneburg2 2003, S. 25.
28 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 67f.
29 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 105f.
30 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 228.
31 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 69.
32 Bruhart, Jean/ Dautry, Jean/ Tersen Emile (Hgg.): Die Pariser Kommune von 1871, Berlin 1971, S. 110.
33 Ansprache der Kommune, veröffentlicht im Journal officiel, Paris 29. März 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 51.
34 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 73.
35 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 160.
36 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 217.
37 Arnould, Arthur: Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, Buch II S. 148.
38 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 155f.
39 Ebd. S. 167.
40 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 233f.
41 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 93ff.
42 Manifest der Pariser Kommune, Paris 20. April 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 91-94.
43 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 242.
44 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 73.
45 Kruse, Wolfgang: Die Französische Revolution, Paderborn/ München/ Wien/ Zürich 2005, S. 37.
46 Kölnische Zeitung, Paris 16. April 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 150f.
47 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 226.
48 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 79.
49 Ebd. 86f.
50 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 98f.
51 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 226.
52 Daily Telegraph, 25. Mai 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 183f.
53 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 97f.
Von den Julitagen 1848 bis zum Vorabend der Kommune
Im Verlauf der ersten Hälfte des 19 Jh. veränderte sich das französische Sozialgefüge drastisch. Die in urbanen Zentren aufkommende Industrialisierung brachte die Entwicklung eines städtischen Proletariats mit sich, welches sich auch politisch als solches zu verstehen begann und ein Klassenbewusstsein entwickelte. So kam es im Juni 1848 zu einer weiteren Revolution und in deren Verlauf zum Bruch der französischen Gesellschaft.
Die Junitage des Jahres 1848 rissen einen Abgrund auf zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat von Paris, der bis jetzt noch niemals zugeschüttet wurde. Eine Bewegung wie die im Juli 1830 oder im Februar 1848 wurde unmöglich. 1
Im Dezember 1848 wurde Napoleon III zum Staatspräsidenten der zweiten Republik gewählt, die aus der Februar Revolution von 1848 hervorgegangen war. Im Dezember 1851 putschte er sich durch die Ausschaltung der Republikaner und Teile der Monarchisten an die Macht und begründete damit 1852 das zweite Kaiserreich. 2 Aussenpolitisch verfolgte der neue Kaiser eine expansive Politik. Im Innern trieb er die Industrialisierung und aufwendige Bauprojekte deutlich voran, was gerade in den Städten ein massives Bevölkerungswachstum mit sich brachte. Während grosse Teile Frankreichs immer noch ländlich geprägt waren, platzten die Industriezentren aus allen Nähten. Ende der 1860er Jahre endete der Bauboom und hinterliess ein Heer von Arbeitslosen. Hinzu kam, dass das Finanzsystem in Folge von übertriebener Spekulation kollabierte, was die Lage zusätzlich verschlimmerte. 3
In der entstehenden Situation versuchte der Kaiser die Gunst der ArbeiterInnen zu gewinnen und änderte daraufhin seine restriktive Arbeitspolitik. 4 So begann er die Bildung von „Arbeitervereinen“ zu fördern und begünstigten. Im Mai 1864 wurde gar ein Gesetz angenommen, welches Streiks legalisierte 5 und im selben Jahr wurden auch die Gewerkschaften legalisiert. Im Jahr 1868 wurde die Zensur deutlich zurückgefahren und somit die Pressefreiheit gestärkt, 6 weiter wurde im selben Jahr ein Gesetz „über die Legalität öffentlicher Versammlungen“ 7 verabschiedet.
Gestärkt durch die erhaltenen Freiheiten verbreiteten sich neue politische Ideen rasant, so vermochte es die Internationale in Frankreich eine wichtige Sektion aufzubauen. 8 Doch auch das Klubwesen, welches schon die Revolution von 1789 geprägt hatte, kehrte auf das politische Parkett zurück. Als Folge politisierte sich die Arbeiterschaft aufs Neue und Klassenunterschiede wurden verstärkt angeprangert. Als der kaiserlichen Administration bewusst wurde, dass ihr die Kontrolle über die Arbeiterschaft zu entgleiten begann, antwortete sie mit massiver Repression. So wurden ab März 1868 Mitglieder der Internationalen verhaftet und verurteilt, und die Organisation als solches wurde faktisch verboten. 9
Obwohl sich das Kaiserreich Napoleons III in einer schlechten Verfassung befand, reagierte es auf preussische Provokationen und der Preussisch-Französische Krieg brach im Sommer 1870 aus. Der Kriegsverlauf wandte sich gegen die deutlich unterlegenen Franzosen. Doch brodelte es auch im Innern und die Machthaber standen zwischen der äussern Front gegen die Preussen und der sich zu erheben drohenden Arbeiterschicht.
Als die Nachricht über die Niederlage bei Sedan nach Paris gelangte, hatte das Kaiserreich keinen einzigen Verteidiger mehr. Die Ausrufung der Republik war ein so ruhig und ohne Aufhebens vollzogener Akt, als ob es sich um eine ganz gewöhnliche und alltägliche Sache handelte. 10
Mitten im Krieg wurde also die dritte Republik konstituiert und an die Spitze des Staates stellte sich eine konservative Regierung der Nationalen Verteidigung. Doch lauerte auch im Verständnis dieser Regierung die grössere Gefahr für das bürgerliche Frankreich im Innern. Die Angst vor einer „roten“ Revolution war grösser als jene vor den Preussen. Dies führte dazu, dass trotz der drohenden Niederlage die Nationalgarde, eine Art Volksbewaffnung deren Wurzeln in der „Levée en masse“ von 1792 und dem Jakobinertum liegen, nicht konsequent eingesetzt wurde. Als am 31. Oktober 1870 bekannt wurde, dass Thiers im Namen der Regierung der Nationalen Verteidigung über einen Waffenstillstand mit den Preussen verhandelte, kam es zu einem Aufbäumen der Pariser Arbeiter und ArbeiterInnen und Nationalgardisten, deren Anführer auf eine „levée en masse“ nach dem Vorbild von 1792/93 drängten. 11
Das Rathaus wurde besetzt, um die Regierungsgewalt zu übernehmen, denn die Aufständischen waren nicht gewillt der Passivität der neuen Regierung weiter zuzusehen. 12 Die Revolte scheiterte aber kläglich und anstelle die Macht zu übernehmen, schwand der Einfluss des erst gerade gebildeten Zentralkomitee der zwanzig Pariser Bezirke und das gegenseitige Misstrauen steigerte sich weiter. Trotz der Scheitern des Aufstandes, vermochten dei Pariser den Druck gegen die Preussen zu kämpfen, aufrecht zu halten. So wurde am 29. November 1870 ein Ausfall gegen die Preussen gestartet, innert drei Tagen fielen an die 12‘000 französische Soldaten. Auch ein zweiter Ausfall am 21. Dezember endete in einer Katastrophe. Diese militärischen Niederlagen führten zum erneuten aufbrechen offener Feindseligkeiten zwischen der Regierung und den immer noch kampfbereiten ArbeiterInnen und Nationalgardisten. So wurde erneut durch das Zentralkomitee der zwanzig Pariser Bezirke der Aufruf zur Konstituierung der Kommune proklamiert. 13
Bei einem weiteren Versuch einen Ausfall gegen die Preussen zu starten, wurde die Nationalgarde aufgeboten und es standen an die 100‘000 Männer zum Kampf bereit, wovon aber nur ein kleiner Teil in die Schlacht geschickt wurde. Logistisch wie militärstrategisch war das Unterfangen zum Scheiterten verurteilt und endete ein weiteres Mal im Chaos. 14 Daraufhin erreichte die „Erregung“ gegen die Regierung einen Höhepunkt und „am Abend des 21. Januars wurde in den Sektionen der Internationalen ein Aufruf zu den Waffen für den folgenden Morgen verteilt“. 15 Der Aufstand kam jedoch nicht zu Stande und am 28. Januar 1871 wurde die Kapitulation von Paris unterzeichnet. Da nun die Regierung der Nationalen Verteidigung durch die Niederlage ihre Legitimation verloren hatte, wurden für den 8. Februar Wahlen angesetzt. Aus den Wahlen gingen als deutliche Sieger die Konservativen und Monarchisten hervor, welche vor allem auf dem Land Stimmen gewonnen hatten. In der in Bordeaux tagendenden 675 Abgeordnete zählenden Nationalversammlung, waren gerademal 150 Vertreter des Republikanertums. 16 Zum Chef der Exekutive wurde der konservative Republikaner Thiers gewählt, welcher später dann auch der erste Präsident der Dritten Republik werden sollte; 17 Regierungssitz wurde Versailles.
Die ersten Amtshandlungen der neuen Regierung Paris betreffend, dienten nicht der Beruhigung der Situation. „Die Patrioten“ enttäuscht von der Kapitulation, waren ihrerseits unzufrieden und der drohende Einmarsch der Preussen zehrte am Pariser Selbstverständnis. Lawrow beschreibt die Situation wie folgt:
Dieses Paris, das soeben noch in dem erregten Zustand der Belagerung gelebt hatte, […] jeden Augenblick in Erwartung des Eindringens der Feinde und zugleich plötzlich der Willkür zufälliger Interessen und Einflüsse ausgesetzt, erhielt aus Bordeaux Nachrichten, die die Interessen der Mehrheit in äusserstem Masse kränkten […]. Das gesamte Kleinbürgertum von Paris war durch die Verfügung vom 11. März in seinen Lebensinteressen verletzt, die besagte, dass alle Wechsel, deren Laufzeit am 13. November 1870 zu Ende gegangen war, am 13. März eingelöst werden müssten (d.h. zwei Tage nach dem Erlass dieser Verfügung, und das in einer Stadt, in der das geschäftliche Leben gerade erst wieder begann). Zugleich lehnet es die Versammlung ab, den Wohnungsmietern zu helfen […], die den Mietsherren die letzten Monate nicht bezahlt hatten und gar nicht hatten bezahlen können. 18
Weiter war für Paris die Tatsache, dass die Regierung weg gezogen war eine gänzlich neue, es fehlte an Polizei auf der Strasse und auch der installierte General hatte zu wenig Mittel, um als Regierungsvertreter Anerkennung zu finden. 19 In dieser Situation, gefördert von einem Besoldungsstreit mit der Zentralregierung, bildete sich die demokratisch orientiere Föderation der Nationalgarde mit einem Zentralkomitee an seiner Spitze. Es kam zu entschlossenen Demonstrationen, in deren Verlauf die Kommune gefordert wurde und auf dem Place de la Bastille wurde erneut die Rote Fahne gehisst. 20 Parallel dazu verabschiedeten die Delegierten der Zwanzig Pariser Bezirke am 23. Februar 1871 eine Resolution für die Bildung einer revolutionären sozialistischen Partei. 21 Nichts desto trotz stand der Einmarsch der Preussen bevor und als bekannt wurde, welche Teile von Paris besetzt werden sollten, ging ein Aufschrei durch die Stadt, denn die Kanonenlager der Nationalgarde sollten in die Hände der Preussen fallen. Kurzentschlossen wurden die Kanonen unter der Leitung des Zentralkomitees der Nationalgarde in die ArbeiterInnenquartiere „in Sicherheit“ gebracht. 22
Die 72 Tage der Pariser Kommune
An diesen Kanonen entbrannte dann auch der bewaffnete Konflikt, welcher zur Ausrufung der Kommune führte. Da sich die Nationalgarde weigerte die Kanonen zurückzugeben, versuchte die Regierung in Versailles sie militärisch zurückzugewinnen. Am 18. März 1871 marschierten Versailler Truppen um drei Uhr Morgens in Paris ein. Aus Mangel an Pferden dauerte der Abtransport der Kanonen zu lange, sodass die Pariser ArbeiterInnen beim Erwachen alarmschlugen. Die Truppen wurden durch die Nationalgardisten und ArbeiterInnen geschlagen und die „Evakuierung“ von Paris wurde durch Versailles eingeleitet. Der Aufstand begann als Verteidigung der Kanonen, endete aber in der politisch motivierten erneuten Besetzung des Rathauses. 23
Aus Mangel an einer gewählten Struktur übernahm das Zentralkomitee der Nationalgarde die Regierungsgewalt, rief aber für den 22. März Wahlen aus. 24 Auf 20‘000 Bewohner sollte ein Gemeinderat entfallen, so lautete der Wahlmodus zur Sicherstellung, dass die ArbeiterInnenbezirke gerechter vertreten sein würden. 25 Wegen konterrevolutionären Demonstrationen, welche in Schiessereien gipfelten, wurden die Wahlen auf den 26. März verschoben, an welchem sie dann auch mit ansprechender Wahlbeteiligung durchgeführt wurden. 26 Zur Zusammensetzung des Kommunalrates schrieb Lawrow:
In ihm befanden sich die Vertreter der neuen Bewegung des Arbeitersozialismus, aber sie befanden sich in der Minderheit; sie setzten sich zusammen zum Teil aus Arbeitern, die Aufgrund des wachsenden Einflusses der Internationalen gewählt worden waren […] zum Teil aus Vertretern der sozialistischen Presse und der Volksversammlungen […] so wie aus einzelnen Persönlichkeiten der Herrschenden Klassen, die sich der Internationalen und dem Sozialismus angeschlossen hatten. Die Mehrheit versammelte sich um das traditionelle Programm des revolutionären Jakobinismus […], oder um das Blanquische Programm der Diktatur. Zu diesen Revolutionären Elementen […], gesellten sich […] auch die Widersacher dieser Revolution. 27
Bookichin bemerkt, dass in dem neuen Rat lediglich vier oder fünf Industriearbeiter vertreten waren. 28 Die 15 Sitze der „Widersacher der Revolution“, beweisen aber auch, dass auch Menschen an den Wahlen teilgenommen hatten, die der Kommune eigentlich ablehnend gegenüberstanden. Trotz ihrer Wahl waren sie nicht in der Kommune vertreten, da sämtliche 15 Abgeordnete von ihren Mandaten zurückgetreten waren. 29 Am Abend des 28. März wird die Kommune offiziell ausgerufen und Tags darauf erschien das erste Plakat des Kommunalrates mit der Überschrift „Republique Française“ und darunter „Liberté – Egalité – Fraternité“. 30 In seiner ersten Sitzung verabschiedet die Kommune eine Reihe von Dekreten, welche vor allem die Mieten betrafen und diese für die Zahlungen, welche während des Kriegs angefallen waren und oftmals noch ausstehend waren, erliessen. Weiter wurde verfügt, dass die Verkäufe der in den Pfandhäusern hinterlegten Güter ausgesetzt werden müssen. 31 In der zweiten Sitzung wandte sich der Kommunalrat dem dringenden Problem der Reorganisation der öffentlichen Strukturen zu. Dies weil, die Verwaltungsstrukturen wegen eines Massenexodus der alten Verwaltung unmittelbar nach der Revolution nahezu gänzlich zusammengebrochen war. Es wurden neun Kommissionen gegründet, 32 welche sofort die Arbeit aufnahmen und innert kurzer Zeit das öffentliche Leben wieder in Gang zu bringen vermochten. In derselben Sitzung, wurde die Konskription abgeschafft und alle wehrfähigen Männer zur Nationalgarde berufen. 33
Doch stand die Kommune auch vor der Herausforderung einen Krieg zu führen. Denn obwohl nicht wenige die Hoffnung hegten, dass der Konflikt mit Versailles friedlich beigelegt werden könnte, standen die Zeichen auf Sturm. Die Kommune verfügte über ein Heer von rund 200‘000 Nationalgardisten, welche sich in Anlehnung an die Nationalgardisten von 1789 „fédérés“ nannten, 34 stand aber vor dem Problem, dass sie nicht wirklich über fähige Armeekader verfügte und auch die Soldaten oftmals nur schlecht geschult waren. Weiter wurde auch das Verhältnis zwischen dem Kommunalrat und des Zentralkomitees der Nationalgarde nie richtig geklärt, was zu verwirrenden Situation führte. So wurde zum Beispiel am 3. April 1871 als Reaktion auf die ersten Angriffe durch Versailler Truppen auf Paris ein Gegenangriff auf Versailles gestartet, ohne dass der Kommunalrat darüber informiert worden war. 35
Auf dem politischen Parkett trieb der Kommunalrat seine Arbeit voran. Per Dekret wurden die höchsten Löhne der Republik auf 6‘000 Francs festgesetzt und eine Angleichungskampagne der Löhne durchgeführt. 36 Am 16. April folgte das Dekret über die Übergabe der verlassenen Werkstätten an Arbeitergenossenschaften. Dies ist eines der wenigen Dekrete, welches den Privatbesitz indirekt angreift und eine explizit sozialrevolutionäre Position einnimmt. Abgeschwächt wurde das Dekret aber durch den Beschluss, den einst zurückkehrenden Besitzern Entschädigungszahlungen zu leisten. 37 Ganz allgemein standen die tatsächlich gegründeten Kooperativen, zirka 40 an der Zahl, vor dem Problem, dass die Kommune auf dem Markt diese Kooperationen nicht bevorzugte und weiterhin von den billiger produzierenden kapitalistischen Fabriken ihre Waren bezog. Diese Politik sollte erst am 12. Mai korrigiert werden. 38
Vor den Toren von Paris wurde weiter heftig gekämpft und die Versailler Truppen zogen den Kreis immer enger um die Stadt, unterstützt wurden sie von Mitte Mai an auch durch die von den Preussen entlassenen Kriegsgefangenen, welche seit dem Preussisch- Französischen Krieg inhaftiert waren. Häufige Wechsel an der militärischen Spitze der Kommune, allgemeine Verwirrung und Disziplinlosigkeit der Nationalgardisten taten das ihrige dazu, dass sich das Kriegsglück nicht wandte. 39
Am 20. April wurde das einzige Manifest der Kommune veröffentlicht. Das Manifest sucht Anschluss an die revolutionäre Tradition Frankreichs. Über die Forderung nach autonomer Gemeindeverwaltung geht es im Wesentlichen nicht hinaus, nahezu gänzlich fehlt das Erarbeiten von Visionen, was doch erstaunt, da Paris zum Zeitpunkt der Verfassung schon belagert gewesen sein musste.
Die Kommune hat kein anderes Ziel als das Recht auf Gemeindeverwaltung, das alle ihr zustimmenden Gemeinden gleichmässig geniessen sollen. […] Die Kommune will administrative und wirtschaftliche Reformen, die die Bevölkerung fordert, […] sie will das Vermögen und das Eigentum verallgemeinern nach den Notwendigkeiten des Augenblicks […]. Unsere Feinde täuschen sich wenn sie Paris anklagen, die Einheit Frankreichs, die durch die Revolution geschaffen worden ist, zerstören zu wollen. […] Was uns betrifft, Bürger von Paris, so haben wir die Aufgabe, die grossartigste und folgenreichste Revolution der Neuzeit durchzuführen. Auf uns ruht die Pflicht zu siegen oder zu sterben. 40
Nachdem sich auch politisch die Lage verschärft hatte und es innerhalb der Kommune brodelte, stellt Miot Ende April den Antrag eine Wohlfahrtsausschuss zu bilden. 41 In einer Abstimmung am 1. Mai wird dieser auch konstituiert, aber nicht ohne heftigen Disput innerhalb der Kommune auszulösen. 42 Denn es war nicht vergessen, dass es eben jene Institution war, welche 1793 zum Gefäss einer autoritären Diktatur mutierte und unter Robespierre 1794 zur Zerschlagung der Kommune diente. 43 Doch auch dieser tiefgreifende Schritt half nichts mehr. Die Kommune war in einen verbitterten Bürgerkrieg verwickelt und viele der Dekrete waren eher symbolischer Natur und richteten sich nicht selten gegen Einrichtungen wie Kirchen und Monumente, so wurde zum Beispiel am 16. Mai die Vendôme- Säule niedergerissen. 44 Einige Dekrete tangierten dann doch noch realpolitische Probleme, so wurde Anfangs Mai verfügt den Brotpreis festzusetzen und kurzzuvor war schon die Nachtarbeit für Bäcker verboten worden. 45
Militärisch wurde die Lage misslicher, dies obwohl immer noch eine grosse Zahl von an die 170‘000 Nationalgardisten verfügbar war. Schafer relativiert diese Zahl jedoch und spricht von gerademal 25‘000 - 30‘000 welche Anfang Mai die Stadt noch verteidigten und um Mitte Mai von gerade mal noch 6‘000 Mann. 46 Am 20. April begannen die Versailler Truppen mit einem massiven Bombardement von Paris und marschierten Tags darauf in Paris ein. 47 Nun beteiligten sich auch wieder vermehrt die Arbeiter und teileweise auch Arbeiterinnen an der Verteidigung ihrer Quartiere. In ganz Paris wurden an die 600 Barrikaden gebaut und verwickelten so die Versiller Truppen in einen heftigen Strassenkampf. Doch Paris war nicht mehr zu halten und ab dem 23. Mai brachen in ganz Paris teils von den Kommunarden strategisch gelegt, teils durch die massiven Bombardements oder von in Rage geratener Nationalgardisten entfacht, grosse Brände aus. 48 Bis zum 28. Mai gingen die heftigen Kämpfe weiter, bis schliesslich die Kommune geschlagen war. 49 Die Versailler Truppen hatten mit äusserster Brutalität zugeschlagen, tausende Kommunarden wurden schon während den Kämpfen niedergemetzelt und viele weitere wurden im Verlauf der folgenden Massenexekutionen hingerichtet. Der Daily Telegraph schrieb am 25. Mai folgende Zeilen dazu:
Blut fliesst in den Rinnsteinen von Paris. Tote liegen in allen Strassen und erstarrte Leichen sind ein gewöhnlicher Anblick an jeder Ecke. Gardisten […] werden […] auf offener Strasse erschossen. Das Hinmorden von Nationalgardisten war seit dem 23. Mai fürchterlich. An diesem Tag begannen die Versailler alle ihre Gefangenen niederzumetzeln. […] Karren fahren umher, um die Toten aufzusammeln, deren Zahl sicherlich jede Schätzung übersteigt. […] Der Bereitwilligkeit zu töten waren keine Grenzen gesetzt. 50/51
Von offizieller Seite wurde von 17‘000 Toten seitens der Kommune gesprochen, Schätzungen von Historikern gehen von mindestens 30‘000 Opfern aus, während die Versailler Truppen 1‘200 Tote zu beklagen hatten. 52
___
1 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871. Geschehnisse- Einfluss- 2 Lehren, Münster 2003 (Ersterscheinung Genf 1880), S. 15. Lawrow spricht damit das 3 Aufklaffen eines Klassenkonfliktes an, welcher bis dahin in den französischen Revolutionen eher zweitrangig war.
4 Geiss, Imanuel: Geschichte Griffbereit. Personen, Band 3, Dortmund 1993, S. 218.
5 Bookchin, Murray: The Third Revolution. Popular Movements in the Revolutionary Era, Volume 2, London/Washington 1998, S. 194.
6 Shafer, David A.: The Paris Commune. French politics, culture and society at the crossroads of the revolutionary tradition and revolutionary socialism, Basingstoke 2005, S 14.
7 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 16.
8 Shafer, David A.: The Paris Commune, S 20.
9 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 17.
10 Theimer, Walter: Geschichte des Sozialismus, Tübingen 1988, S. 91.
11 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 197.
12 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 44.
13 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 204
14 Ebd. S. 207f.
15 Ebd. S. 209-211.
16 Ebd. S. 212.
17 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 54.
18 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 214.
19 Geiss, Imanuel: Geschichte Griffbereit, S. 207.
20 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 59.
21 Arnould, Arthur: Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, Bruxelles 1878, Buch I S. 92.
22 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 61.
23 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 214.
24 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 58.
25 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 60-63.
26 Ebd. S. 65.
27 Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich. März bis Mai 1871. Die Pariser Kommune in zeitgenössischen Berichten, Lüneburg2 2003, S. 25.
28 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 67f.
29 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 105f.
30 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 228.
31 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 69.
32 Bruhart, Jean/ Dautry, Jean/ Tersen Emile (Hgg.): Die Pariser Kommune von 1871, Berlin 1971, S. 110.
33 Ansprache der Kommune, veröffentlicht im Journal officiel, Paris 29. März 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 51.
34 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 73.
35 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 160.
36 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 217.
37 Arnould, Arthur: Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, Buch II S. 148.
38 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 155f.
39 Ebd. S. 167.
40 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 233f.
41 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 93ff.
42 Manifest der Pariser Kommune, Paris 20. April 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 91-94.
43 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 242.
44 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 73.
45 Kruse, Wolfgang: Die Französische Revolution, Paderborn/ München/ Wien/ Zürich 2005, S. 37.
46 Kölnische Zeitung, Paris 16. April 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 150f.
47 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 226.
48 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 79.
49 Ebd. 86f.
50 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 98f.
51 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 226.
52 Daily Telegraph, 25. Mai 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 183f.
53 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 97f.
22 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 61.
23 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 214.
24 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 58.
25 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 60-63.
26 Ebd. S. 65.
27 Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich. März bis Mai 1871. Die Pariser Kommune in zeitgenössischen Berichten, Lüneburg2 2003, S. 25.
28 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 67f.
29 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 105f.
30 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 228.
31 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 69.
32 Bruhart, Jean/ Dautry, Jean/ Tersen Emile (Hgg.): Die Pariser Kommune von 1871, Berlin 1971, S. 110.
33 Ansprache der Kommune, veröffentlicht im Journal officiel, Paris 29. März 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 51.
34 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 73.
35 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 160.
36 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 217.
37 Arnould, Arthur: Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, Buch II S. 148.
38 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 155f.
39 Ebd. S. 167.
40 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 233f.
41 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 93ff.
42 Manifest der Pariser Kommune, Paris 20. April 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 91-94.
43 Bookchin, Murray: The Third Revolution, S. 242.
44 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 73.
45 Kruse, Wolfgang: Die Französische Revolution, Paderborn/ München/ Wien/ Zürich 2005, S. 37.
46 Kölnische Zeitung, Paris 16. April 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 150f.
47 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 226.
48 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 79.
49 Ebd. 86f.
50 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 98f.
51 Lawrow, Pjotr L.: Die Pariser Kommune vom 18. März 1871, S. 226.
52 Daily Telegraph, 25. Mai 1871 in: Bolz, Alexander: Bürgerkrieg in Frankreich, S. 183f.
53 Shafer, David A.: The Paris Commune, S. 97f.
 Dieses Werk ist unter einer
Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.
rageo - 5. Okt, 10:53 Article 2658x read
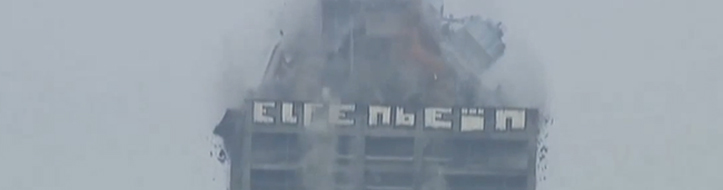



Trackback URL:
https://rageo.twoday.net/stories/5975567/modTrackback